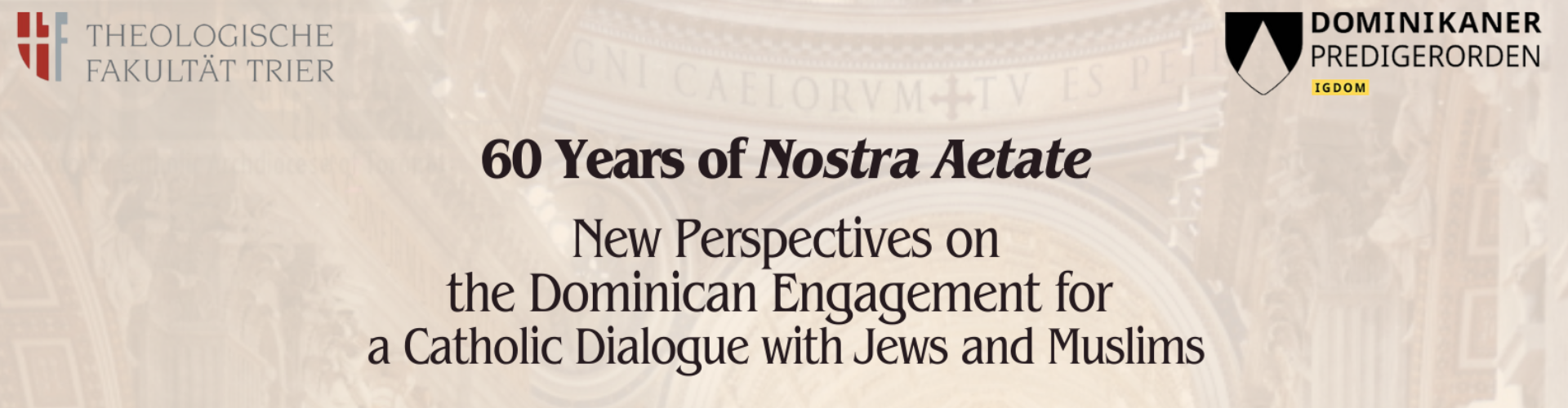
Vom 19. bis 21. Januar 2024 fand in Trier eine internationale Fachtagung statt, die sich dem Beitrag von Dominikaner*innen zur Neubestimmung des kath.-jüdischen und kath.-muslimischen Verhältnisses in der ersten Hälfte des 20. Jhs. aus historischer und theologischer Perspektive widmete. Denn dieses dominikanische Engagement hatte damals maßgeblich zum kirchlichen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung anderer Religionen beigetragen. Was schließlich in die Konzilserklärung Nostra Aetate gemündet ist.
Für die Organisation der Fachtagung (Programm s.u.) zeichneten das Institut zur Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum (IGDom) und der Lehrstuhl für Abrahamitische Religionen mit Schwerpunkt Islam und interreligiöser Dialog an der Theologischen Fakultät Trier verantwortlich.
Elias H. Füllenbach OP
Dennis Halft OP